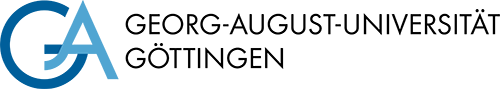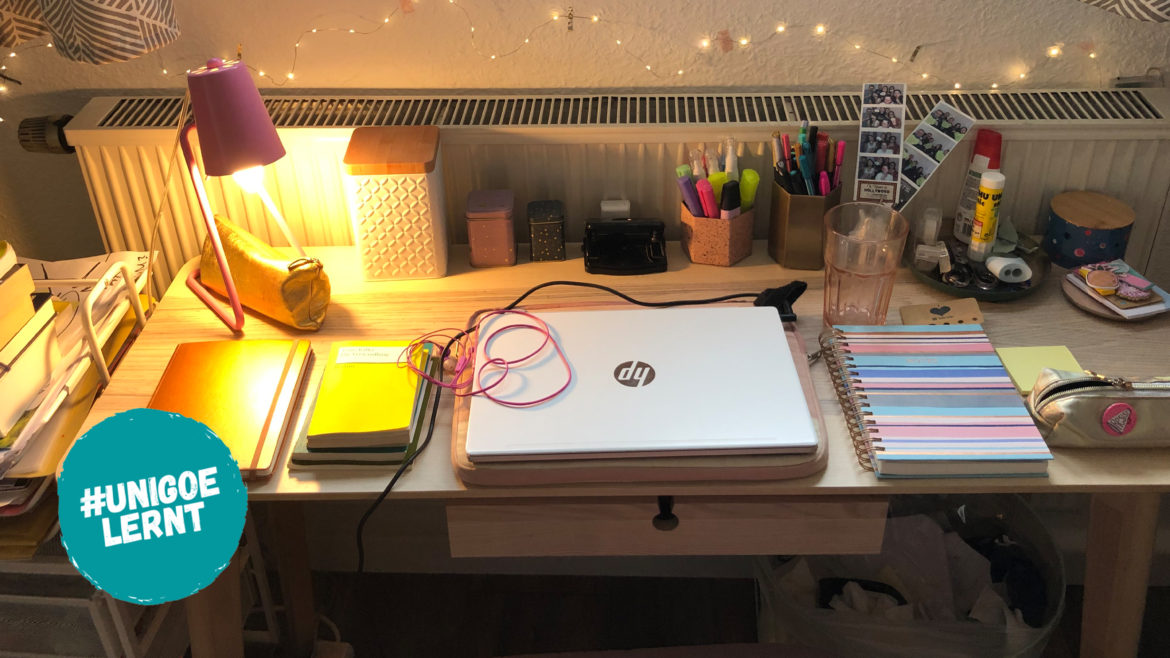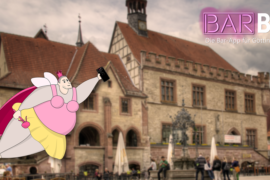Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Welt auf den Kopf gestellt, sondern auch unsere privaten Leben. Das Digitalsemester verlangt von Studierenden, sich an Situationen anzupassen, die noch vor einem halben Jahr undenkbar waren: an Seminaren teilnehmen vom eigenen Sofa aus; Hausarbeiten schreiben, ohne Zugang zu Bibliotheken; arbeiten, ohne einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu haben. Das hat auch Folgen für die eigene Arbeitsweise: Noch viel stärker als früher muss man sich selbst organisieren, die eigene Zeit einteilen, sich motivieren, diszipliniert bleiben. Keine leichte Aufgabe – mit der auch ich hin und wieder zu kämpfen habe. Insgesamt habe ich das Home-Office-Leben, so glaube ich, eigentlich ganz gut im Griff. Trotzdem gibt es Tage, an denen einfach nichts läuft. Ich hänge schlapp zu Hause herum, kann mich nicht konzentrieren, alles, was ich schreibe, ist unbrauchbar. Das ist ungünstig, denn eigentlich hatte ich geplant, in diesem Semester mit der Masterarbeit zu beginnen. Also verabrede ich mich zu einem Video-Call mit Aljoscha Niklesz von der Zentralen Studienberatung. Er wird mir helfen, Störfelder in meinem Alltag ausfindig zu machen, die dafür sorgen, dass an manchen Tagen alles schiefgeht.
Zunächst fragt er mich, was mein wichtigstes Ziel im Moment ist. Na klar: Masterarbeit schreiben! Dann konkreter, was dafür die nächsten Schritte sind. Ich überlege – erst einmal ist die Recherche wichtig, die Lektüre von Primär- und Sekundärliteratur, die wahrscheinlich am besten im Juni erledigt sein sollte, um danach mit dem eigentlichen Schreiben beginnen zu können. Herr Niklesz will wissen, ob das realistisch ist. Da ich schon angefangen habe, sage ich optimistisch ja. Dann hakt er nach: Welche Abweichungen und privaten Ablenkungen kann ich ausmachen, die mich vielleicht davon abbringen werden, dieses Ziel zu erreichen? Ich denke nach, zuerst fallen mir vor allem äußere Faktoren ein: ein Besuch bei meiner Familie, geschlossene Bibliotheken und damit fehlender Zugang zu Büchern, die ich brauche. Schließlich gestehe ich mir aber auch ein, dass auch ich selbst ein Faktor bin. Während der Arbeit an meinem Exposé habe ich schon gemerkt, dass es mir im Home Office manchmal schwer fällt, den Absprung vom morgendlichen Herumlümmeln in den Arbeitstag zu finden – etwas, das leichter ist, wenn man dafür den Weg ins Büro antritt, als wenn dieser Weg nur noch fünf Schritte bis zum Schreibtisch beträgt. Das sorgt dann manchmal dafür, dass ich an einem Tag längst nicht das schaffe, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte.
Herr Niklesz fragt mich nach Frühwarnzeichen, die einen dieser Tage andeuten. Wieder muss ich überlegen, dann gebe ich zu, dass ich das häufig schon direkt beim Aufwachen merke, wenn ich langsamer wach werde, mehr Zeit mit morgendlichen Social-Media-Konsum, Frühstück und Auswahl der Leggings des Tages vertrödele. Er fragt, ob es eine einfache Lösung wäre, den Wecker früher zu stellen. Ich verneine – manchmal kann ich mich auch dann bis in den später Vormittag nicht zur Arbeit aufraffen, wenn ich um 7 Uhr aufgewacht bin. Also bittet Herr Niklesz mich, den Gedanken, der mich an solchen Tagen vom Arbeiten abhält, genau zu fassen und als Satz zu notieren. Ich schreibe: „Ich habe ja den Tag über genug Zeit, deshalb ist es nicht nötig, möglichst früh anzufangen.“ Tatsächlich ist das die Ausrede, die ich mir selbst häufig liefere. Mit dem Uni-Alltag fehlen auch viele feste Termine, die früher meinen Tag strukturiert haben: nicht nur Seminare und Vorlesungen, sondern auch Arbeitsbesprechungen, Mensa-Verabredungen, Unternehmungen mit Freund*innen, Sport-Kurse. Diese haben mir früher immer geholfen, um die Zeit dazwischen einzuteilen, bestimmte Zeiträume effektiv für Arbeit zu nutzen und andere für Freizeit freizuhalten. Seit dem Beginn der großen Seuche gibt es solche Termine wesentlich seltener oder sie finden virtuell statt – das macht es für mich schwieriger, meinen Arbeitstag so zu strukturieren, dass er einen festen Anfang und Ende hat. Früher habe ich oft mit einer Art Belohnungssystem gearbeitet: Wenn du bis 17 Uhr die Vorbereitung fürs Seminar komplett geschafft hast, kannst du danach die Verabredung zum Abendessen sorgenfrei genießen. Das funktionierte eigentlich immer gut. Aber nun, da es weniger Abwechslung im Alltag gibt, gibt es auch weniger Belohnungen – mein Motivationssystem ist kollabiert. Theoretisch steht mir an vielen Tagen der gesamte Tag zur freien Verfügung, denn ich muss ja nirgendwo sein. Doch ohne Druck entstehen oft auch keine sonderlich brillanten Arbeitsergebnisse.
Nachdem ich den Satz formuliert habe, bittet mich Herr Niklesz, zu überlegen, was ich dem entgegensetzen könnte. Gemeinsam kommen wir zu dem Schluss, dass es wirkungsvoll ist, wenn ich mir meine Zeit zum Arbeiten selbst begrenze und so plane, dass ich guten Gewissens einen Schlussstrich ziehen und zu einem bestimmten Zeitpunkt den Stift fallen lassen und mich anderen Dingen widmen kann – seien es virtuelle oder distanzierte Treffen mit Freund*innen, Sport oder kreative Projekte. Er schlägt mir vor, morgens eine halbe Stunde zu nehmen, um meinen Abend zu planen, wie ich ihn gerne verbringen würde. Somit habe ich etwas, auf das ich mich freuen kann und einen Anstoß, um die Arbeit besser früher als später zu beginnen. Ich finde diesen Lösungsvorschlag überzeugend, da ich ohnehin wahnsinnig gerne plane. Vor meinem inneren Auge sehe ich mich bereits bunte Listen für die Abendgestaltung schreiben und bin zuversichtlich.
Danach kommen wir auf eine weitere Dimension meiner gelegentlichen Demotivation zu sprechen: die räumliche. Ich habe noch nie gerne von zu Hause gearbeitet, sondern habe stets exzessiven Gebrauch von Bibs, Cafés und Büroräumen gemacht. Ein Faktor ist dabei sicherlich auch die Ablenkungsgefahr (ich wisch nur noch einmal schnell Staub, gieße alle Pflanzen, stell eine Waschmaschine an, sortiere das Geschirr nach Farben und verlege neue Fliesen im Bad, aber danach fange ich aber wirklich ganz sicher an mit Schreiben), aber eher noch die Trennung der Sphären: Mir ist es lieber, zum Arbeiten woanders hinzugehen und mein Zimmer so als Rückzugsort zu behalten, an dem ich tun und lassen kann, wozu ich Lust habe. Doch im Moment habe ich keine andere Wahl, als hier auch zu arbeiten und das führt manchmal dazu, dass ich Seminarlektüre lieber in einer keineswegs rückenschonenden Position und im Pyjama auf Bett oder Sofa erledige, anstatt mich an den Schreibtisch zu setzen – nur um dann hinterher zu merken, dass sinnerfassendes Lesen an diesen Orten gar nicht mal so gut funktioniert oder auf einmal festzustellen, dass ich ungeplant in ein kleines Nickerchen entglitten bin. Wieder bittet Herr Niklesz mich, die Gedanken, die mich sirenenartig vom Schreibtisch weglenken, konkret als Satz zu formulieren. Ich schreibe: „Auf dem Sofa ist es viel bequemer, also arbeite ich heute von dort.“ Und wieder soll ich überlegen, welche Gegenargumente ich habe – was würde es mir bringen, wenn ich mich an den Schreibtisch setze? Die Antwort fällt mir leicht: Ich könnte wieder eine Aufteilung meines Zimmers in Arbeits- und Freizeitzonen schaffen. Der Schreibtisch wäre dann da für Uni und sonstige Arbeit, Bett und Sofa reserviert zum Chillaxen. Damit wäre es für mich wiederum einfacher, morgens den Punkt zum Arbeitsstart zu finden, indem ich ihn mir mit dem Umzug an den Schreibtisch signalisiere.
Herr Niklesz fragt, ob es ein Symbol geben könnte, was mich auf dem Weg zum Sofa aufhält und an den Schreibtisch lockt. Wenn dort ohnehin alle Bücher liegen, mutmaße ich, würde ich mich doch dorthin setzen, anstatt theoretische Literatur im Umfang meines halben Körpergewichts quer durchs Zimmer zu schleppen, nur um beim Lesen auf dem Sofa herumlungern zu können. Er schlägt vor, dass es sinnvoll sein könnte, es zur Routine zu machen, meinen Schreibtisch schon am Vorabend so herzurichten, dass ich mich morgens gerne zum Arbeiten daransetze. Ich soll versuchen, mir den idealen Arbeitsplatz zu visualisieren und tatsächlich habe ich sofort ein Bild vor Augen: Laptop in der Mitte, links daneben die Bücher, die ich dringend brauche, etwas weiter weg jene, die ich nur ab und zu konsultiere. Auf der rechten Seite ein Notizblock, Stifte in verschiedenen Farben, Pagemarker und Post-its. So würde es sich gut arbeiten lassen. Gleichzeitig, so erklärt mir Herr Niklesz, würde mir das Vorbereiten des Schreibtischs auch helfen, genau den Punkt festzulegen, an dem ich mit der Arbeit für den Tag fertig bin – was mit meiner ersten Problematik helfen würde.
So habe ich mir also zum Ende des Gesprächs die Störfelder bewusst gemacht, die mich vom – wie Herr Niklesz sagt – zielgerichteten Handeln abhalten und weiß, was ich tun kann, um ihnen zu begegnen. Ich fühle mich bestärkt. Tatsächlich waren mir viele der Gedanken, die mich auf Faulenzerei-Irrwege führen, gar nicht bewusst. Es ist gut, mit jemand anders darüber zu sprechen und sich diese ganz konkret bewusst zu machen, auch sprachlich. Das Gespräch im Video-Call war wesentlich entspannter als ich es erwartet hätte; Herr Niklesz ist ruhig und freundlich, hört zu, ohne zu beurteilen und erkennt präzise, wo Probleme liegen und welche Vermeidungsstrategien ich mir selbst einrede.
Am Ende des Tages tue ich wie mir empfohlen: Ich ordne Bücher, Stifte und sonstige Arbeitsutensilien auf dem Schreibtisch so, wie ich sie am nächsten Morgen gerne finden würde. Alles andere räume ich weg oder ordne es so, dass es nicht im Weg liegt. Außerdem mache ich mir einen Plan für den nächsten Tage: Was kann ich realistisch schaffen, was wäre sinnvoll als nächster Schritt. Die Ergebnisse schreibe ich mir auf und hake dabei gleichzeitig alle Dinge ab, die ich heute schon erledigt habe. Außerdem setze ich mir eine Uhrzeit für den nächsten Tag, zu der ich anfangen möchte sowie eine, zu der ich mit der Arbeit fertig werden will und überlege mir, zu welchen Zeiten ich Pausen einlegen möchte. Als ich vom Schreibtisch aufstehe und einen Blick zurückwerfe, bin ich zufrieden. An diesem Arbeitsplatz kann ich mir vorstellen, morgen zu arbeiten.
Am nächsten Morgen beschleicht mich beim Blick aus dem Fenster in den morgendlichen Regen das Verlangen, mich einfach wieder umzudrehen. Welchen Unterschied macht es schon, um 10 statt um 9 anzufangen, flüstert eine Stimme in meinem Kopf. Aha, ein Störfeld, krakeelt sogleich eine andere und ich rufe mir meine guten Vorsätze wieder ins Gedächtnis: Eine Stunde später anfangen heißt eine Stunde später aufhören, erinnere ich mich selbst. Also visualisiere ich meine Abendplanung: Um 20 Uhr habe ich eine Verabredung, bis zu der ich alles geschafft haben sollte. Idealerweise würde ich vorher gerne noch joggen und etwas essen, also sollte ich um 18 Uhr mit der Arbeit fertig sein. Mit dieser Perspektive vor Augen raffe ich mich auf. Nach dem Frühstück fühle ich mich immer noch einigermaßen bereit, mich in die Arbeit zu stürzen. Doch wieder merkt eine Stimme in meinem Kopf an, dass es doch viel angenehmer und somit bestimmt auch effizienter sei, diesen Arbeitstag in der Sofaecke zu verbringen, wozu ist man schließlich im Home Office. Überzeugend, denke ich, bis mein Blick auf den gestern eingerichteten Schreibtisch fällt. Und tatsächlich hat das Bild, das sich mir dort bietet, etwas Verlockendes. Schließlich siegen meine Hemmung, die gestern akkurat arrangierten Stapel zu zerstören, sowie meine Unlust, den ganzen Kram durchs Zimmer zu schleppen und ich beziehe Stellung am Schreibtisch. Und siehe da, tatsächlich verbringe ich danach einen recht produktiven Tag, nach dem ich alle Punkte auf meinem Zettelchen abhaken kann.
Natürlich klappt das nicht an allen Tagen. Manchmal will alles einfach nicht so, wie ich es gerne hätte – und jeden Tag volle Leistung von mir selbst zu verlangen, wäre auch unverantwortlich. Das hat auch Herr Niklesz in unserem Gespräch zur Beruhigung gesagt: Es ist keineswegs schlimm, manche Tage ungenutzt vorbeiziehen zu lassen. Im Gegenteil, manchmal kann das auch gerade notwendig sein, um neue Energie zu sammeln. Doch die Störfelder-Methode hat mir geholfen, mir bestimmte Denk- und Verhaltensmuster vor Augen zu führen und mit diesen umgehen zu lernen. Dadurch fällt es mir leichter herauszufinden, wann ich mir selbst etwas vormache und wann ich tatsächlich eine Pause brauche. Insgesamt erhöht das die Anzahl der Stunden, die ich zum einen für sinnvolles Arbeiten und zum anderen für entspannende Freizeit ohne schlechtes Gewissen nutzen kann. Ich kann euch also empfehlen: Meldet euch für einen Videocall bei der Studienberatung an oder schnappt euch eine*n Freund*in, Mitbewohner*in oder Familienmitglied, mit denen ihr im Gespräch versucht, Störfelder in eurem Alltag zu finden.
Die gesamte #unigoelernt-Reihe mit all ihren Expert*innen-Tipps findet Ihr hier im Instagram-Highlight.