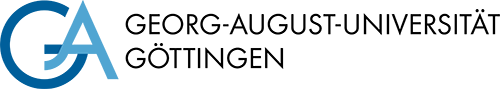Mein erster richtiger Tag an der University of Arkansas beginnt um 7.30 Uhr. Ich bin seit zwei Wochen in den USA, habe die O-Phase hinter mir und mich ein wenig eingelebt. Den gestrigen Sonntag habe ich mit meinen neuen Freund*innen an einem See etwas weiter nördlich verbracht, wo wir gepicknickt und Bier aus roten Bechern getrunken haben, geschwommen sind und Volleyball gespielt haben. Es war ein perfekter Tag, doch nun geht der Ernst des Lebens wieder los und der erste Tag der Vorlesungszeit steht bevor.

Die Universität liegt im Süden der USA, im Staat Arkansas, der wegen seiner wunderschönen Natur, den vielen Bergen, Wäldern und Flüssen den Beinamen „The Natural State“ trägt. Die Studierendenstadt Fayetteville hat etwa so viele Einwohner*innen wie Göttingen und einen hübschen Stadtkern, in dem es von Street Art, Bars, Theatern, kleinen Shops und Galerien nur so wimmelt – in dieser Hinsicht ist die Umstellung also nicht besonders schwierig. Nur das Fahrradfahren macht hier weniger Spaß: Zwar stehen überall Leihfahrräder herum, die man mit einer App für wenig Geld nutzen kann, doch da die Stadt in den Ozark Mountains liegt, ist sie sehr hügelig. Vom Campus trennt mich eine Straße mit schätzungsweise 45 Grad Steigungswinkel, die ich im Traum nicht mit dem Fahrrad erklimmen werden. Also laufe ich. Das ist ungewöhnlich – die meisten amerikanischen Studierenden haben ein eigenes Auto, die internationalen Student*innen (von denen es hier eine Menge gibt) benutzen in der Regel die Busse, die von der Uni betrieben werden und für alle Einwohner*innen der Stadt umsonst sind. Sie fahren jedoch nur bis 22 Uhr und am Sonntag überhaupt nicht. Dann muss man sich auf Uber verlassen; nachts gibt es auch die Möglichkeit, für den Heimweg ein „Safe Ride“ zu rufen. Der Service der Uni bringt eine*n umsonst nach Hause.

In meinem ersten Seminar sitzen knapp 10 Studierende plus Professor, wir passen an einen Konferenztisch. Zum Einstieg spielen wir ein Kennlernspiel; zwei Wahrheiten, eine Lüge. Dass ich das erste Mal in den USA bin, entlarven alle ziemlich schnell einstimmig als Lüge. Vielleicht liegt das aber eher dran, dass es offensichtlich ist, dass ich nicht gelogen habe, was meine Lieblingstiere Schweine angeht. „Who doesn’t love pigs“, sagt jemand und ich fühle mich sehr zu Hause. Doch mit meiner Vorliebe für Borstentiere bin ich auch in der richtigen Stadt gelandet: Das Maskottchen des Football-Teams der University of Arkansas ist ein Wildschwein, ein „razorback“ oder „hog“. Überall auf dem Campus verteilt finden sich Schweine-Statuen verschiedener Größen, verschiedene Ecken der Stadt schmücken bemalte geflügelte Schweine. Bei den Footballspielen der „Razorbacks“ (die Mannschaft heißt in der College League üblicherweise nach dem Maskottchen) existiert ein demütigendes Ritual namens „Hog Call“: Zu den Worten „Woo Pig Sooie“ werden in einer nicht wirklich komplizierten, aber für Anfänger*innen dennoch herausfordernden Choreographie die Arme in die Luft geschmissen. Die Ursprünge dieses eigentümlichen Anfeuerungsrufs sind unbekannt, er soll jedoch in den 20er-Jahren entstanden sein.

Nachdem wir uns kennengelernt haben, geht das Seminar los, die Atmosphäre ist entspannt und locker, niemand hebt die Hand, sondern alle reden einfach in den Raum hinein. Der Professor gibt sich nahbar, spricht alle mit Vornamen an. Die Sitzung dauert fast drei Stunden – das ist hier eine von zwei Optionen, die andere ist zwei Seminarsitzungen pro Woche mit je 75 Minuten. Alle Seminare verlangen ein hohes Lesepensum, zusätzlich gibt es mindestens alle zwei Wochen Seminaraufgaben, die eingereicht werden müssen. Diese sind mehr an der akademischen Praxis orientiert: Grant Proposals (im Grunde eine Übung für Anträge auf Forschungsgeld, in denen man ein aktuelles Forschungsvorhaben kurz und anschaulich vorstellen muss), Lektürelisten, Seminarpläne müssen geschrieben werden. Ich verstehe so langsam die ganzen Gerüchte, die ich während der O-Phase gehört habe über den Stress der „grad school“, über Schlafmangel und Sparmaßnahmen wie die Ausnutzung aller Gratis-Mahlzeiten bei Uni-Events. Meine drei Jobs wie in Göttingen könnte ich bei diesem Workload sicherlich nicht nebenbei stemmen – was ich allerdings auch nicht müsste: Master-Studierende ohne Stipendium haben alle eine Research oder Teaching Assistantship, arbeiten also für Professor*innen, erledigen lästige Recherche-Arbeiten, geben Einführungskurse – ähnlich wie SHKs oder WHKs an deutschen Universitäten. Im Ausgleich müssen sie kaum Studiengebühren zahlen, kriegen ein Gehalt und reduzierte Kursarbeit: Statt drei Seminaren müssen sie jedes Semester nur zwei belegen. Wer seinen PhD, den Doktor, macht, ist ebenfalls in der grad school eingeschrieben und arbeitet am Institut, belegt im ersten Jahr Kurse und legt dann mit der Dissertation los. Einen Master-Abschluss braucht man dafür nicht unbedingt, wer ein vierjähriges Bachelorstudium absolviert hat, kann sich danach sofort in die Promotion stürzen. Nachdem ich mich im vergangenen Semester lange durch den Informationswust zur Promotion in Deutschland gequält habe, wirkt dieses System beneidenswert einleuchtend.
Nach der Hälfte des Seminares stelle ich fest, dass im Raum eine angenehme Temperatur herrscht. Das ist bemerkenswert, weil ich seit meiner Ankunft stets zwischen Schwitzen und Frieren oszilliere. Im Freien brennt die Sonne und die Luftfeuchtigkeit erschwert das Atmen, sodass es noch heißer wirkt. Drinnen läuft die Klimaanlage auf Hochtouren und ich habe mir angewöhnt, einen Pulli einzustecken, womit ich unter Amerikaner*innen sofort auffalle. Denn alle anderen sitzen fröhlich in Träger-Top und Shorts bei 15 Grad Raumtemperatur da, während ich mir bibbernd einen Schal um die Schultern wickle. Heute aber trage ich nur ein T-Shirt und fühle mich ungewohnt wohltemperiert. Etwa fünf Minuten später sagt ein Seminarteilnehmer in die Runde: „Do y’all think it’s hot in here?“ Ringsherum wird Zustimmung laut, also macht man sich daran, die Klimaanlage höher zu drehen. Rauschend setzt sie sich in Bewegung, zehn Minuten später hülle ich mich in meinen Pulli. Die Akklimatisierung wird wohl noch ein wenig dauern.

Nach dem Seminar bin ich im Gym verabredet. Es gibt an der Uni zwei davon: eines in der Union, einem großen Gebäude in der Mitte des Campus, in dem Studierende Kaffee trinken, essen, kopieren, Videospiele spielen oder auch einfach nur rumhängen können. Das andere Gym liegt ein Stück entfernt, im Sportzentrum beim Football-Stadion. Darin finden sich mehrere Turnhallen, Squash-Plätze, ein Fitnessraum, ein Schwimmbad, eine Kletterwand, und eine Laufstrecke. Wir entscheiden uns, laufen zu gehen, was in der gekühlten Halle wesentlich angenehmer ist als draußen auf dem sengenden Asphalt. Wohl erst im Herbst werden wir dafür den Trail nutzen können, eine Strecke zum Radfahren und Spazierengehen, die quer durch die Stadt zum Botanischen Garten und zum See führt.
Den Abend verbringen wir mit Einkäufen für die kommende Woche – was schonmal etwas dauern kann, denn die Supermärkte sind riesig. Die Auswahl beim „kleinen“ Walmart bei mir um die Ecke ist auch am Abend noch ungefähr doppelt so groß wie in den Läden in Göttingen. Besonders an Süßigkeiten, Softdrinks und Chips reihen sich unvorstellbare Mengen in den Regalen aneinander. Beim Brot sieht es hingegen eher mau aus, lange suche ich nach einem, das auch ungetoastet genießbar aussieht. Meine Suche nach einem Club-Mate-Ersatz wird nicht von Erfolg gekrönt und ich muss einsehen, dass ich wohl entweder auch bei 35 Grad Kaffee trinken oder immer müde sein muss. Als ich zu Hause mit meiner Mitbewohnerin koche, stellt sich heraus, dass es gar nicht so einfach ist, die gleichen Rezepte wie zu Hause mit anderen Zutaten zu kochen. Die amerikanischen Produkte enthalten andere Inhaltsstoffe, da die gesetzlichen Regelungen hier nicht so streng sind wie in der EU. Das Ergebnis ist zwar essbar, aber schmeckt doch anders als in meiner Göttinger WG-Küche. Als ich später nach einem aufregenden ersten Tag ins Bett falle, kann ich trotzdem den nächsten Tag und das kommende Semester kaum erwarten.
Blug-Reporterin Hanna studiert zurzeit an der University of Arkansas in den USA. Hier berichtet sie unter dem Titel „BLUG goes USA“ regelmäßig von ihren Erlebnissen im amerikanischen Campus-Alltag.