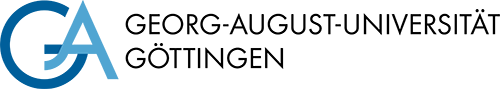Ich bin ein Digital Native. Ich habe miterlebt, wie Videokassetten ausstarben, um von Streaming-Diensten abgelöst zu werden, und war gerade auf dem Gymnasium, als das erste Smartphone auf den Markt kam. Ich weiß, wie man auf Instagram Hashtags setzt und ich kenne den Unterschied zwischen einem Retweet und einem Fav. Trotzdem setze ich beim Schreiben von Hausarbeiten alle meine Fußnoten manuell und verbringe Stunden damit zu überprüfen, ob ein „ebd“ an eine falsche Stelle gerutscht ist. Denn ich habe keinen blassen Schimmer, wie man digitale Werkzeuge nutzen kann, um diese lästigen Arbeiten an den Computer zu delegieren. Das kommt euch bekannt vor? Dann dürfte euch das Projekt „Digitale Kompetenzen für Studierende “ interessieren. Es wird – wie unter anderem auch der BLUG – im Rahmen der Initiative Campus QPLUS finanziert, das die Qualität von Studium und Lehre an der Uni verbessern soll. Tatyana Tasche leitet das Projekt zusammen mit ihrer Kollegin Silvia Czerwinski von der SUB. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie damit Studierenden digitale Kompetenzen beibringen will, die ihnen im Studium und im Berufsleben weiterhelfen – und wieso wir die überhaupt so dringend brauchen.
„Zunächst war das Projekt als Brückenschlag zwischen Schule und Studium gedacht“, erklärt Tasche zu Beginn des Gesprächs. Abiturient*innen sollten auf die digitalen Herausforderungen des Studiums vorbereitet werden. Doch im Gespräch mit Lehrenden hörten Tasche und ihre Kolleg*innen immer häufiger, dass es auch Studierenden, die schon länger an der Uni sind, häufig an digitaler Kompetenz mangelt. Sie sprachen mit Lehrenden und führten eine Umfrage unter Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen durch, um herauszufinden, welche digitalen Kompetenzen für diese beiden Zielgruppen im Studium interessant wären. Besonders für Statistik interessierten sich viele der Befragten.
Tatsächlich habe ich bisher wenig darüber nachgedacht, wie genau mir Statistik in meinem Komparatistik-Studium weiterhelfen kann. Schließlich kämpfe ich mich für meine Hausarbeiten stets eher durch einen Sumpf aus Theorie und Sekundärliteratur, als dass ich dafür Datenmengen sammle, analysiere und fein säuberlich in Diagrammen aufarbeite.
„Wir hoffen, dass das Projekt die Hemmschwelle gegenüber Daten und Statistik senkt.“
Tasche versteht meinen Einwand. Sie hat selbst einen Master in Interkultureller Germanistik in Göttingen gemacht: „Damals dachte ich auch, als Geisteswissenschaftlerin muss ich nicht mit Daten arbeiten.“ Doch die Annahme sei falsch, schließlich könnten sich durch neue Darstellungsmöglichkeiten auch neue Fragestellungen ergeben. Sie gibt mir ein Beispiel: Bei einem Vergleich der Charaktere in Schillers Drama „Die Räuber“ könne man die Kommunikation und Beziehungen untereinander in einem Netzwerk darstellen und so zu neuen Analyse-Ergebnissen kommen. „Wenn ich in meinem Masterstudium so eine Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich vielleicht auf ganz andere Ideen gekommen“, sagt Tasche. „Wir hoffen, dass das Projekt die Hemmschwelle von Geisteswissenschaftler*innen gegenüber Daten und Statistik senkt.“
Als großer Fan von Flow Charts, systematischen Darstellungen und bunten Markierungssystemen finde ich ihren Vorschlag überraschend vielversprechend. Doch woran liegt es, dass bei so vielen Studierenden anscheinend die digitalen Fähigkeiten fehlen, um auf solche Ideen zu kommen? Laut Tasche ist es ein Irrtum, davon auszugehen, dass Digital Natives sich mit allem rund um Computer bestens auskennen. „Die Usability von Computern ist heute so gut, dass man gar kein grundlegendes Wissen über ihre Funktionsweise mehr braucht“, erklärt sie. Ich muss zugeben, dass sie damit Recht hat. Zwar verdrehe ich gerne dramatisch entnervt die Augen, wenn ich meiner Mutter erklären muss, warum sich der Bildschirm auf ihrem Smartphone nicht mehr ins Querformat drehen lässt, aber trotzdem halte ich es insgeheim für schwarze Magie, dass eine Nachricht, die hunderte Kilometer weiter weg verfasst wurde, innerhalb von Sekunden auf meinem Display erscheint. Scheint also, als wäre ich Teil der Zielgruppe, an die sich Tatyana Tasches Projekt richtet.
Also werfe ich einen Blick in die Kurse. Sie alle sind online in ILIAS, dem Lernmanagementsystem der Universität, frei zugänglich. Bisher gibt es zwei, einen rund ums Thema Literaturrecherche und einen zu Open Educational Resources, also freien Bildungsmaterialien. Zurzeit arbeiten Tasche und ihr Team an einem dritten, in dem es um Informationsvisualisierung gehen soll, und auch ein weiterer zum Thema Daten ist im Gespräch. Alle Kurse sind stets in fünf bis sechs Kapitel aufgeteilt, die einzeln in 20 bis 30 Minuten bearbeitet werden können. Das soll nicht nur Studierenden die Möglichkeiten geben, genau die Teile zu bearbeiten, die ihnen besonders wichtig erscheinen, sondern auch Dozierende dazu ermutigen, Abschnitte aus den Kursen in ihre Lehre einzubauen.
Irgendwann, so hofft Tasche, sind die Kurse dann vielleicht sogar im Curriculum vorgesehen. Bis dahin sind sie als Selbstlernkurse gedacht. Um Studierende einen Anreiz zu geben, ihre rare Freizeit in eLearning zu investieren, sind diese möglichst vielfältig gestaltet, mit unterschiedlichen Medien wie Videos und Texten, um viele verschiedene Lerntypen anzusprechen. „Ich spiele selbst gerne, daher versuche ich, möglichst viele spielerische Elemente in die Kurse einzubauen“, sagt Tasche. „Am Ende jedes Abschnitts gibt es ein kleines Quiz.“ Auch Teilnahmebestätigungen kann man am Ende eines bestandenen Kurses bekommen. In Zukunft ist auch geplant, kurze Videos zu erstellen, zum Beispiel mit Tipps zum Thema Back-ups und Datensicherung. Ich denke verschämt an die externe Festplatte, die seit Monaten in meinem Regal einstaubt, und nehme mir vor, dieses Video dringend einmal anzuschauen, wenn es fertig ist.
„ELearning ermöglicht verschiedensten Leuten den Zugang zu Bildung.“
Und noch einen weiteren Vorteil hat das eLearning laut Tasche: „Es ermöglicht verschiedensten Leuten den Zugang zu Bildung, das ist mir persönlich sehr wichtig.“ Trotzdem haben die Möglichkeiten beim Online-Lernen auch ihre Grenzen. Manchmal brauche man jemanden, der über die Schulter schaue und bei Problemen helfe. „Das ist der Nachteil beim eLearning“, sagt Tasche, „als Lehrende kann man nicht spontan auf die Bedürfnisse der Lernenden reagieren.“
In der Hoffnung auf neue Erkenntnisse für meine derzeitige Hausarbeit (und zugegebenermaßen auf willkommene Ablenkung durch die Quizze) mache ich den Kurs zu Literaturrecherche. Auch wenn ich vieles schon aus dem Bachelorstudium weiß, entdecke ich darin doch einige wertvolle Tipps und finde prompt einige brandaktuelle Artikel zu meinem Thema, die ich bisher bei meiner Suche übersehen hatte. Auch als Digital Native gibt es für mich also noch einiges an digitalem Neuland zu beschreiten. Und wer weiß, vielleicht schmückt sich schon meine nächste Hausarbeit mit weniger verschachtelten Theorie-Zitaten und dafür mit mehr akribischen Diagrammen.